Es gibt einen Raum in unserem Haus, der mich regelmäßig unruhig macht. Denn in unserem Keller stoße ich immer wieder ganz konkret darauf, dass mit dem Konsumverhalten meiner Familie irgendetwas nicht stimmt.
Besuchern erzähle ich manchmal im Scherz, dass unser Keller „ein ganz wunderbarer Ort“ ist: Wie von Zauberhand fülle er sich immer wieder neu mit allem möglichen Zeug, das die Kinder, meine Frau oder ich aussortiert haben. Da gibt es alte Sessel und Regale, Bretter, Kartons voller Spielsachen, ausrangierte Computertechnik, Kabel, leere Flaschen, Verpackungen von Haushaltsgeräte und und und… Alles Mögliche eben, das wir eigentlich nicht mehr brauchen, aber zu schade zum Wegwerfen finden.
Und dann passiert immer wieder das gleiche: Zuerst steht das Zeug eine Weile herum, bis der Keller immer voller und schließlich kaum noch passierbar ist. Dann misten wir in einer Hauruck-Aktion aus: Sortieren Dinge aus, die wir noch verkaufen oder verschenken können. Überlassen noch brauchbare Möbel in der Hoffnung, dass irgendjemand gerade so ein Tisch oder Sessel braucht, der Caritas für deren „Möbelfundgrube“. Fahren den Rest zum Wertstoffhof oder entsorgen ihn gleich in unsere Mülltonne. Und – Bravo! – freuen uns, dass der Keller wieder wunderbar aufgeräumt aussieht, und sind im Wortsinn erleichtert, dass wir es geschafft haben, uns von all dem Ballast zu trennen.
Bravo? Echt jetzt?
Mit jeder Aufräum-Aktion bringt mich unser Keller mehr ins Grübeln. Wie kommt das eigentlich, dass wir fast unbemerkt nach und nach und dann irgendwie doch überraschend immer mehr besitzen, als wir brauchen? Dass wir damit unseren engsten und wichtigsten Lebensraum, nämlich unser Zuhause, zustellen und quasi an unserem eigenen Überfluss ersticken? Ist das nicht ein deutliches Indiz, dass unser Lebensstil, unsere Art zu konsumieren aus dem Ruder läuft? Aber wo und ab wann genau? Alles, was wir bei diesen Aktionen als überflüssig erkennen, verkaufen, verschenken, wegschmeißen: Das kam ja nicht angeflogen, vielmehr haben wir Geld und Zeit darauf verwendet, es anzuschaffen, und uns darüber gefreut!?
Am Ende läuft diese Grübelei zwangsläufig auf die eine Frage hinaus: Was brauche ich, was brauchen wir wirklich, um „gut“ leben zu können?
Neulich habe ich gelesen, dass ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland vor 100 Jahren etwa 400 Dinge besaß, heute dagegen ungefähr 10.000. Wenn diese Zahl auch nur annähernd stimmt, dann erscheint sie mir wie ein Gradmesser, dass wir unser Maß verloren haben. Und es gefällt mir nicht, dass ich selbst und dass meine Familie Teil dieser Maßlosigkeit sind.
„Du übertreibst!“, findet meine Frau oft, wenn ich den Blick kritisch durch unsere Wohnung schweifen lasse und befinde: „Das ist mir hier alles zu voll!“ Sie urteilt da meist milder, weist mich zum Beispiel augenzwinkernd auf die Geschichte oder den Nutzen von Dingen hin, die ich am liebsten sofort verbannen möchte: „Das Foto ist doch das Geschenk von Peter! Wenn er uns besuchen kommt und das Foto dann nicht mehr auf der Kommode steht – was dann?“ oder: „Wenn wir die Lampe jetzt ‘rauswerfen, dann kaufst du in zwei Monaten doch wieder eine neue, weil es dir beim Lesen dann zu dunkel ist.“ Lisa weiß auch meist besser, warum es sich manchmal lohnt, auch mal etwas aufzuheben: „Die alten Kinderbücher könnten wir später noch brauchen, wenn wir mal Enkel haben, und ärgern uns dann, wenn wir sie weggegeben haben.“
Mir ist inzwischen auch klar, dass vieles, was ich als überflüssig ansehe, einfach der Geschichte unserer Familie geschuldet ist. Wie die große Kiste voller Lego im Keller, mit dem niemand mehr spielt. Vielleicht geht es damit ja irgendwann wie mit unserem Kleinkind-Equipment, das wir in der Nachbarschaft verschenkt haben. Und es macht mich durchaus zufrieden, wenn ich unser altes Bobbycar wieder mal über die Straße rattern höre und sehe.
Und ich gebe zu: Möglicherweise ist es weniger die Überfüllung der Wohnung als unser Lebensstil insgesamt, der mein Unbehagen auslöst. Eigentlich möchte ich als Christ so leben, dass ich ein gutes Gewissen haben kann. Ich will mir nicht vorwerfen müssen, mit meinem Konsumverhalten die Schöpfung mit Füßen zu treten, unnötig Ressourcen zu verbrauchen oder die Flut an Müll noch zu vergrößern. Denn bei allem Bemühen um einen verantwortlichen Lebensstil passiert es mir und der ganzen Familie immer mal wieder, dass Dinge quasi im „Vorbeigehen“ aus einer Laune heraus gekauft und konsumiert werden, die wie etwa Fastfood nicht nur ungesund, sondern auch unnötig verpackt sind. Etwa als ich mir als Technik-Freak neulich eingebildet habe, ich muss mir unbedingt ein tolles neues GPS direkt in China bestellen, das mich dann auf dem See- oder Flugweg über tausende von Kilometern erreicht – nur damit ich dann feststelle, dass das Gerät zwar möglicherweise in Asien, nicht aber hier in Deutschland funktioniert. Ein konsumistischer Schnellschuss für die Tonne quasi für den ich mich hinterher geschämt habe, der aber viel über die Fallen aussagt, in die ich gerne einmal unüberlegt hineintappe.
Unsere Kinder, inzwischen 25 und 22 Jahre alt, stellen sich die meisten Fragen in Sachen Lebensstil so gar nicht, die mich umtreiben. Trotzdem leben sie absolut nicht unkritisch und zeigen einen gut ausgeprägten Sinn für die Bedürfnisse anderer und die schwierige Umweltproblematik in all ihren global vernetzten Zusammenhängen. In den letzten Fastenzeiten etwa wollten sie selbst auf Fleisch oder auf stundenlanges Serienschauen verzichten. Das finde ich schön, auch wenn eine temporäre Selbstbeschränkung sicher nicht ausreicht, unseren Planeten zu retten. Dazu müsste sich schon grundlegend der Lebensstil ändern. Ich bekenne: Mein eigener Lebensstil taugt leider auch nicht unbedingt als Vorbild, wenn mich auch selbst diese Fragen ganz schön umtreiben. Und selbst gute Vorbilder versagen ja oft: Im Bekanntenkreis gibt es eine Familie, deren Kindern von den Eltern jahrelang Bio-Müsli und viel Gemüse vorgesetzt bekamen – und jetzt ihren Generationenprotest bei Burger King ausleben.
Was bleibt? Der Versuch, meinem Unbehagen über die Zustände in unserem Keller auf den Grund zu gehen, führt mich mitten hinein in die Hintergründe des hyperkonsumistischen Lebensstils unserer Zeit und die globalen, oft sündhaften Verkettungen von Ausbeutung und Ausnutzung fremder Ressourcen und Arbeitskraft. Für mich ist das Gordische Knoten der Jetztzeit schlechthin. Ich kann ihn weder aufdröseln noch zerschlagen, sondern muss zähneknirschend erkennen, das ich mit meiner Familie Teil davon bin, dass ich verstrickt bin in ökonomische Zusammenhänge, die ich weder voll überblicken noch privat ganz überwinden kann. Mit Bewunderung verfolge ich Bemühungen wie das „Zero Waste“-Experiment einer befreundeten Familie, die eine Woche lang versuchte, keinen Müll zu verursachen. Auch wenn sie danach wieder zu etlichen „alten“ Gewohnheiten zurückkehrte – geblieben ist auf jeden Fall ein wacheres Bewusstsein für das eigene Konsumverhalten. Es gab gute Gespräche mit den eigenen Kindern und auch mit Freunden, in denen über Alternativen für bisher Selbstverständliches nachgedacht wurde. Vielleicht ist das ja ein Weg aus meinem Gordischen Knoten: in kleinen Schritten nach Alternativen suchen, Zeichen setzen, drüber reden, bewusst einkaufen – und auch einfach mal einen Einkauf sein zu lassen.
Und noch etwas anderes scheint mir eine Spur zu sein: meine Lust daran, mich von überflüssigen Dingen zu trennen und sie, wenn möglich, sinnvoll los zu werden. Das hat für mich quasi eine reinigende Wirkung: Ich lasse Vergangenes los und stoße mich selbst auf die oft verdrängte Frage: Was brauche ich wirklich zum Leben? Die Antwort mag je nach Lebensphase anders ausfallen und nie endgültig sein. Aber es tut gut, sich ihr immer wieder neu zu stellen.
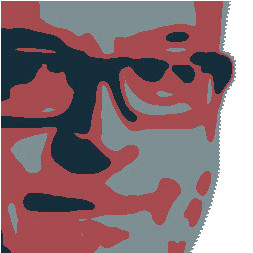

Als Erster einen Kommentar schreiben